
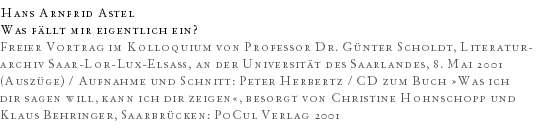
Günter Scholdt: Arnfrid Astel kennen Sie, soweit ich hier umschaue, im wesentlichen alle. Er ist Lyriker, Epigrammatiker, er ist Literaturredakteur beim Saarländischen Rundfunk a. D., und nicht zuletzt hat er als Anreger und als Lehrer einer Poetenschule hier bedeutende Verdienste erworben. Von daher erspar ich mir weitere Ausführungen. Die meisten, die hier sind, kennen ihn, und es wäre ein bißchen Eulen nach Athen tragen, wollte ich jetzt da noch große Ausführungen machen – ja, genug der Vorrede, Sie haben das Wort.
A.: Ja, danke. Mein Vorschlag für diese Ausstellung, der Titelvorschlag, ist »Was ich dir sagen will, kann ich dir zeigen«. Das wird nachher auch als ein Zitat in einem Text vorkommen, und da sozusagen die Gedichte und ihre Gegenstände oder, in anderer Reihenfolge, die Gegenstände und ihre Gedichte zusammenkommen in dieser Ausstellung, fände ich das ganz günstig. ›Trouvaille‹ ist natürlich auch ein schöner Titel, aber unter Trouvaille fällt alles, was man findet, und ich… als dünkelhafter Mensch denke ich natürlich, daß ich ganz besondere Sachen finde, und deshalb mag ich diesen Titel im Grunde lieber. Was ich dir sagen will – das ist das Gedicht –, kann ich dir zeigen. Ich hab auch so ein paar Gegenstände mitgebracht, fällt mir gerade ein, und die kann man ja vielleicht mal rumgeben. Vorher will ich noch was sagen. Auf der Einladung, die Herr Scholdt freundlicherweise verschickt hat, bin ich angekündigt als jemand, der liest, referiert, plaudert, spektakelt, happeningt oder was auch immer – ich muß Sie, glaube ich, mit dem Happeningen und Spektakeln entschuldigen: da ich mich jetzt in der dritten Lebenshälfte befinde, (Lachen) bin ich ruhiger geworden.
Günter Scholdt: Och, ich fand, daß zum Beispiel die… diese Kunstpreis-Veranstaltung schon etwas von Happening hatte.
A.: Ja. Ja, sie war ja auch ein Ereignis, nicht? Ja.
Günter Scholdt: Hoffen wir, daß das auch passiert.
A.: Mal schaun. Schaun mer mal. Ja, ich hab hier zwei Sachen mitgebracht, wenn Sie das vielleicht so weitergeben und, wenn Sie so freundlich sind, es nicht kaputtschlagen würden. (Lachen) Das wäre irgendwie ganz nett. Ist auch schwer kaputtzuschlagen. Zum Titel hier, zum Beispiel dieses… diese Übung, so heißt es, glaub ich – ich hab es immer ein Seminar genannt –, das freundlicherweise Gerhard Schmidt-Henkel mit seiner beschützenden Hand protegiert hat, ja?, lange Zeit, wofür ich ihm sehr dankbar bin, ja –
Gerhard Schmidt-Henkel: Es war offiziell ein bezahlter Lehrauftrag im ersten Semester, und dann viele, viele Jahre ein unbezahlter Lehrauftrag, das wollen wir nicht vergessen zu erwähnen.
A.: Ja, ja. Ja, das erste Semester – ja. Aber ich meine, außer dem Geld gibts ja auch noch das Vergnügen, ja? Und wenn man eh im Gelde schwimmt… Wozu Geld, nicht? Das ist ja lächerlich. (Lachen) Hab ich noch was vergessen? Man vergißt immer alles. Ich wollte noch was zu dem Titel sagen – »Was fällt mir eigentlich ein?«, heißt er, glaub ich –, das ist entstanden in einer Diskussion mit einem Kollegen. Und ich weiß nicht, ob Sie das noch wissen, die älteren unter Ihnen wissen wahrscheinlich, daß der Satz »Was fällt dir eigentlich ein?« ein pädagogischer Warnsatz ist, ja? Was bildest du dir eigentlich ein, was nimmst du dir da heraus? Und »Was fällt mir eigentlich ein?« – in dieser Diskussion mit dem Kollegen wollte ich, was übrigens nicht von Erfolg gekrönt war, auf die Dialektik des Einfalls hinaus. Und ich für mich bilde mir eigentlich ein, daß das, was einem eigentlich einfällt, sehr wohl mit dem Verbotenen zu tun hat. Das heißt: natürlich fallen uns nicht nur die anständigen Einfälle ein, und wenn man zuläßt, was einem einfällt, was einem eigentlich einfällt, ist das ein heikles Thema, ja? Und das meiste von dem, was einem da eigentlich einfällt, kann man eigentlich nicht sagen. Und man könnte jetzt überspitzt sagen: Literatur ist das Schreiben des Unbeschreiblichen. Wenn sie etwas taugt, ist sie ja eigentlich, nach meiner Erfahrung, so, daß sie etwas leistet, was man eigentlich nicht machen kann. Nicht nur nicht machen sollte oder nicht machen darf, sondern eigentlich auch nicht kann. Das heißt, das, was uns eigentlich einfällt, unsere Erfahrungen, die ja nun vorwiegend keine akademischen Erfahrungen sind, sondern Lebenserfahrungen, Liebeserfahrungen und so weiter – wir reden ja nicht nur deshalb nicht darüber, weil es unanständig wäre unter Umständen, sondern weil wir es gar nicht können. Wir haben gar kein – sagen wir, ja, wieder dialektisch gesagt – gar kein ›anständiges‹ Vokabular dafür. Aber was ist wieder die Dialektik des Anstands, ja? Was ist das Unanständige? Was ist das Verbotene? Der Kollege übrigens, mit dem ich damals darüber diskutieren wollte, der hat dann gesagt, das sei eine absolut altmodische Ansicht, heute sei ja alles erlaubt. Aber als ich seine Gedichtbücher gelesen habe, fiel mir auf, worüber er alles nicht schreibt. Es kann natürlich sein, daß ihm das auch nicht einfällt. Dann wäre er aus dem Schneider. (Lachen) Ich glaube wirklich, daß der Einfall, der ja auch mal irgendwie einen kultischen Zusammenhang hatte, also was einem die Musen oder die Götter oder wer auch immer, oder die Mutter Natur oder Diana oder sonstwas eingibt, das könnte einem ja auch einfallen, ja? – also ich denke wirklich, daß dies ein heikles Gebiet ist und daß es deshalb interessant sein könnte, sich darauf einzulassen. Genauer gesagt, ich weiß für mich, daß es für mich interessant ist, sich darauf einzulassen. Und ich gehe wirklich, ich will das nochmal wiederholen, ich gehe so weit, daß eigentlich für mich Literatur immer die lesenswert war, die das gesagt hat, was man eigentlich nicht sagen kann. Sag ich mal so, ja? Es ist alles etwas überspitzt und so weiter, aber es soll ja auch deutlich werden. Ja. Jetzt hab ich vor, von einem Einfall auszugehen, der eigentlich mehr von den Augen kam und gar kein Einfall war. Ich bin kürzlich im Winter mit einer Freundin meiner Freundin spazierengegangen, und wir kamen zurück an einer Weinbergsmauer, und da wuchs Feldsalat. Also das, was man Rapunzel nennt oder Mausohrsalat und so weiter. Und das war so angeschwemmte Erde, sehr leichtes Erdreich. Und ich habe das Pflänzchen rausgezogen. Im Winter sind das richtige Rosetten, später, im Sommer, ist der Feldsalat nicht so günstig, da hat er in der Mitte eine Blüte und so weiter. Also diese schöne Rosette, die wir schätzen als den Wintersalat, hab ich rausgezogen und habe, zu meiner Überraschung, festgestellt, daß diese Rosette, die praktisch keine Höhe hat, sondern ganz flach, wie ein… wie ein Sonnenrad – ›Sonnewirbele‹ nennt man, hab ich mir sagen lassen vom Christoph Michel, ja?, die sagen das, in Freiburg nennen die das Sonnewirbele oder so ähnlich – ja, zu meiner Überraschung hab ich festgestellt, daß dieses Pflänzchen eine so lange Wurzel hat. Und diese Freundin meiner Freundin und ich, wir haben wie im Chor gesagt, als wir das gesehen haben: Rapunzel, laß dein Haar herunter. Ja? Und das ist irgendwie… hat mich seitdem nicht mehr so verlassen, und ich habe dann auch so Illustrationen, Märchenillustrationen mir angekuckt, zum Beispiel von Otto Ubbelohde, von dem kürzlich auch in dieser Ex-Libris-Ausstellung in der Universitätsbibliothek Beispiele waren, daß der speziell dieses Rapunzelmärchen illustriert hat, daß dies… in einem Holzschnitt. Und dieses Märchen wurde immer wieder illustriert. Und es gibt im Gebrüder-Grimm-Museum in Kassel eine Broschüre über eine spezielle Ausstellung zu diesem Märchen. Das würde zu weit führen, das alles zu erklären. Die Grimms haben sich darin geirrt, daß es sich um ein Volksmärchen handelt, es ist ein Kunstmärchen aus Italien, ursprünglich nicht auf Rapunzel, sondern auf Petersilie bezogen. Das wurde dann ins Französische… ist im Französischen aufgetaucht und wurde nach Deutschland… kam nach Deutschland über Frankreich. Und dann irgendwie zwischendurch hat das mal umgesattelt auf Rapunzel, ja? Das ist alles kompliziert und einfach und schön und – jedenfalls für mich ist es nicht mehr von der Hand zu weisen, zumal seitdem ich auch die ganzen Illustrationen gesehen habe. Unter anderem Otto Ubbelohde, ich hab das, glaub ich, auch hier, ich hab das auch nebeneinander einmal abgelichtet, daß das genau die Struktur des… der Wurzel ist: Das ist die Originalgröße einer Rapunzelpflanze, hier ist die lange Wurzel. Hier ist das Bild von Ubbelohde, wo Rapunzel, ja?, das Haar herunterläßt, an dem sich dann die Hexe und auch ihr Freier hochseilt. Und so weiter. Also mich interessiert das sehr, und wenn man mal sich mit so ner Sache beschäftigt, dann kommt ja immer mehr zusammen. Dann erfährt man zum Beispiel – übrigens auch wieder von Christoph Michel, dem von mir sehr verehrten Fachmann und Literaturwissenschaftler, ja?, der ja hier auch Vorlesungen hält, ja?, die… ja, sehr interessante Vorlesungen, im letzten Semester über Hofmannsthal –, der hat mir gesagt, der Otto Ubbelohde, der auch aus der Gegend von Kassel kommt, ähnlich wie die Brüder Grimm, der hat in seinen Illustrationen wirkliche Gebäude, die man lokalisieren kann, verwendet. Dieses Fachwerkhaus hier, wo in einem Erker Rapunzel ihr Haar herunterläßt, ist in dem Ort Amönau – wieder eine schöne Fundsache, daß der Amönau heißt, eine liebliche Aue, bei Wetter, ja?, in der Wetterau – noch erhalten. Ich habe Abbildungen gesehen, und es ist nicht von der Hand zu… es ist also ganz klar, daß es sich um das gleiche Gebäude handelt. Also dies hat auch Namen und Anschrift, solche Sachen, das ist irgendwo vorhanden. Wenn man mit diesen Rapunzelsachen beschäftigt ist, und dann kommt… stolpert man noch über den Ort Amönau, ja?, dann ist man schon wieder in der Versuchung, zu desertieren zu dem neuen Fundstück, nämlich diesem schönen Ort Amönau. Den gibt es wirklich. Ich habe also im Shell-Atlas nachgekuckt, das ist ungefähr so im Uhrzeigersinn drei auf der Seite soundsoviel, bei Wetter in der Wetterau. Und da ich in letzter Zeit mich mit silbenzählenden Gebilden, also nicht metrischen, die ja die Versfüße zählen oder behandeln, sondern mit silbenzählenden Gebilden beschäftige, zum Beispiel mit einem, das man – aber ich ungern – Haiku nennt, mit siebzehn Silben, fünf, sieben, fünf, und ich hab das auch verkürzt, hab also sozusagen eine Erfindung gemacht, mit einem Kollegen zusammen, Werner Laubscher – aber wir haben nur einen sehr unbefriedigenden Namen dafür gefunden, nämlich das ›Stutzhaiku‹, das ist also noch kürzer, das besteht… ›Stutz-‹, also so wie ein Stutzflügel oder eine Stutzflöte oder so etwas. Für Kinder, wenn die Kinder Geige spielen sollen, dann kriegen sie eine Stutzgeige, oder es gibt noch einen Stutzflügel. Übrigens bei der Schale, fällt mir gerade auf, hab ich gar nicht dazugesagt, was Sie vielleicht hätten bemerken können, daß da eine Inschrift drum rum geht. (Zwischenrufe) Haben Sie das bemerkt, ja? (Lachen) Das find ich sehr gut.
Günter Scholdt: Ein aufgewecktes Kolloquium.
A.: Ja, ja, das ist… es war auch keine Falle, ich habs wirklich nur vergessen…
Teilnehmer: Was fällt Ihnen eigentlich ein?
A.: Was fällt Ihnen eigentlich ein, ja. Dieses ›Stutzhaiku‹ heißt natürlich »Amönau«, hat ne Überschrift, und heißt »Rapunzel / bei Wetter und Wind / bei Laune.« Rapunzel bei Wetter und Wind bei Laune. Amönau liegt bei Wetter, das ist die Kreisstadt, ja? Und verspielte, unernste Menschen wie ich, die lassen sich hinreißen zu solchen Albernheiten und machen aus dem »bei Wetter« auch dann »bei Laune«, und irgendwie gefällt mir auch das, ja? Jetzt ist diese schöne blaue Schale unbeschädigt wieder angekommen, dann les ich mal den Spruch vor – oh, die ist ganz warm geworden. Das kommt von der Bewegung. Die hat sich heißgelaufen. Das heißt: »Eine Schale / in meiner Hand / und in der Schale / das Himmelsgewölbe / und aus dem Gewölbe / trinken wir Wein / und sehen die Sterne.« Das ist eine Aneignung aus der Griechischen Anthologie, den Autor hab ich im Augenblick, glaub ich, vergessen, es könnte Antipatros von Thessalonike sein oder sowas. Die Griechische Anthologie, Sie kennen das vielleicht, das ist eine sehr umfassende, eigentlich die größte Anthologie, die aus der Antike überliefert ist, mit lauter Epigrammen, wohl einigen Tausend, ja?, sechzehn Bücher. Und das ist übersetzt von dem Herrn Beckby, der immer seinen Vornamen verschweigt, da ist nur ein Buchstabe, ich hab aber den dann auch vergessen. Beckby hinten mit Ypsilon, ein verdienstvoller Altphilologe, der hat diese übersetzt, und das ist ne zweisprachige Ausgabe, die ursprünglich bei Tusculum erschienen war. Und da sind natürlich lauter solche Gedichte drin, die sich auf Gegenstände beziehen. Epigramme beziehen sich nämlich auf Gegenstände. Das sind eigentlich Aufschriften oder Inschriften. Also eine Grabschrift ist ein Epigramm, möglicherweise, und so weiter. Ein Begleitgedicht zu einem Geschenk ist ein Epigramm, ja?, das auf das Geschenk Bezug nimmt. Und in dieser Anthologie sind zwei oder drei Epigramme, die sich auf ein verlorengegangenes Geschenk beziehen. Die Geschenke gehen verloren, oder bleiben bei ihrem Eigentümer, sind Privatbesitz, ja? – Die Literatur hat ja den Vorteil, daß sie keine Originale schafft. Also man kann sich leichter von seinen Produkten trennen. Es gibt… ich möchte nicht Maler sein oder Bildhauer, der jedesmal, und wenn er noch so viel Geld dafür kriegt, sich von diesen schönen Kindern trennen muß, die es nur einmal gibt, ja? Also wie gesagt… und diese Epigramme beziehen sich auf einen Himmelsglobus. Das kennen Sie vielleicht, was ein Himmelsglobus ist. Man kann also die Sternbilder so auf einen… auf eine Halbkugel projizieren, und untendrunter die andere. Das ist also sozusagen die nördliche Halbkugel, untendrunter ist die südliche. Wenn Sie das aber… einen Himmelsglobus machen, dann besehen Sie das von außen, ja? Es ist also ziemlich egal, ob man nun im Himmel lebt oder von außen sich den Himmel so vorstellt wie die Erde. Und da gab es wohl in der Antike solche Schalen, die nun keinen Spruch hatten – den Spruch hab ich erst dadran machen lassen –, die aber in dieser Schale den Sternenhimmel hatten. Den man nicht sah, wenn Rotwein drin war. Und man trank im allgemeinen Rotwein. Aber wenn man die Schale geleert hatte, dann sah man den Himmel, ja? Und das so ein bißchen in das Triviale und uns Geläufige gelenkt, daß man Sterne sieht, wenn man betrunken ist, das verlockt mich natürlich auch, ja? (Lachen) Weil man dann sozusagen die trivialen Ausdrücke wieder dahin zurück befördern kann, wo sie hingehören, nämlich in den Himmel. Und es ist eigentlich eine Schande, so trivial zu sein. (Lachen) Ich lese es nochmal vor… Und das ist, der Poetik nach, etwas vollkomen anderes, es ist ein freirhythmisches Gedicht, es ist weder silbenzählend noch Versfüße zählend. Die Epigramme in der Griechischen Anthologie sind meist Kleinst-Elegien, das heißt Hexameter und Pentameter. Ein Epigramm ist mindestens ein Hexameter und ein Pentameter und manchmal zwei solche Paare oder drei oder sieben, wenns hoch kommt, ja? Also das alles hab ich mir hier geschenkt. Weil es ja auch redundant ist im Grunde. Redundant geworden. Wir sind ja überfüttert mit diesen Sachen, und wenn man soviel Homer gelesen hat und Voßsche Übersetzungen und dann noch die Xenien unserer Klassiker, dann ist man ein… des Versmaßes ein bißchen müde. Und man macht dann aus lauter Verzweiflung aus dem Haiku ein ›Stutzhaiku‹ oder aus dem Hexameter ein freirhythmisches Epigramm, und das heißt, ich lese es nochmal vor: »Eine Schale / in meiner Hand / und in der Schale / das Himmelsgewölbe / und aus dem Gewölbe / trinken wir Wein / und sehen die Sterne.« So. Klar? Ja. Was wollt ich sagen? Ja, im Rundfunk hat man uns früher immer gesagt – jetzt ist man davon abgekommen –: Ihr müßt euch einfach ausdrücken, damit euch die einfachen Leute auch verstehen. Und ich hab immer gesagt, erst einmal: Ihr unterschätzt die einfachen Leute. Die sind gar nicht so einfach, die sind sogar kompliziert. Im Grunde… dialektisch gesehen, ist, wer simpel ist, der akademisch Gebildete. Der kann sozusagen seiner Schwierigkeit Herr werden, indem er über alles reden kann – oder wenigstens glaubt, es zu können. Das heißt, die Verbalisierung ist ja in Wirklichkeit eine Vereinfachung. Also man ist doch Herr seines Trieblebens weitgehend, wenn man es verbalisieren kann, zum Beispiel. Ich denke, der sprichwörtliche Bäcker an der Ecke ist ein viel Getriebenerer als wir… Wie bitte? (Lachen) Nochmal?
Zwischenruf: Wegen der Hefe.
A.: Wegen der Hefe, ja, das ist wahr. Das ist wahr, ja. Ja, die akademischen Treibmittel, die müßte man erforschen, ja? (Lachen) Ja, also ich dachte mir, ich brauche mich nicht dumm zu stellen als Redakteur, weil ich – halten Sie das bitte nicht für ne Koketterie – auch mich selbst für einen relativ einfachen bis einfältigen Menschen halte. Das werden Sie natürlich als Koketterie nehmen, aber ich sage Ihnen, es stimmt gar nicht. Die Naivität – und wenn man noch so raffiniert ist, ja?, und wenn man noch so sehr… ja, sophisticated ist, ist die Naivität ein Gut, das ich persönlich nicht missen möchte. Ohne Naivität entsteht nichts. Die Naivität ist das Natürliche, wie ja alle Etymologen wissen, ja? Das ist das… die Naivität kommt von der Natur. Falls Kluge/Götze da nicht gepfuscht hat, stimmt das. Kluge/Götze ist das Lexikon, wo man das nachschlagen kann. Inzwischen wahrscheinlich beim Duden. Aber ich merke, ich komme ins Reden, was ja immer ne schöne Sache ist, nicht?, da geht die Zeit rum. Ich wollte eigentlich bei Rapunzel bleiben, ja? Oder zu Rapunzel zurückkommen. Und das mach ich natürlich auch. Daß dies alles nicht Hand und Fuß hätte, ist übrigens ein Irrtum. Das ist alles von langer Hand ausgedacht. Aber es ist natürlich interessanter, wenn man das so versteckt, als hätte man sich gar nichts dabei gedacht. Ja, ich möchte jetzt doch noch einmal ein paar Sachen, vielleicht ohne viel dazu zu reden… Und wie Sie vorhin etwas gesagt haben, bitte machen Sie das dauernd. Ich bin für jede Unterbrechung dankbar, ja? Also nicht, daß ich hier die ganze Zeit rede und so. Sagen Sie Ihrs dazwischen, und bitte nicht nur Fragen, sondern Behauptungen. Das ist eigentlich das Interessantere. Das schüchtert mich immer ein, wenn nach Lesungen angeboten wird, man dürfe jetzt noch Fragen stellen. Ich hab meist gar keine. Ich hab aber Ansichten, ja? Also ich lese jetzt mal, ohne weiter etwas dazu zu sagen – wird mir wahrscheinlich mißlingen – so ein paar Rapunzelgedichte vor. Ja, jetzt wieder ein Rapunzelgedicht, das ist sozusagen weder metrisch noch silbenzählend, sondern freirhythmisch. »Die Locken / verlocken mich. / Demeters Zöpfe / sind dreizeilige / Weizenähren. / Wasser fällt / herunter vom Turm. / Der Strahl ist ein Zopf. / Der zieht uns hinan.« Ich bin dann doch schnell wieder abgekommen von dieser freirhythmischen Art, die hieß… ich les es doch nochmal, »Rapunzel« ist die Überschrift: »Die Locken / verlocken mich. / Demeters Zöpfe / sind dreizeilige / Weizenähren. / Wasser fällt / herunter vom Turm. / Der Strahl ist ein Zopf. / Der zieht uns hinan.« Nun in ›Stutzhaikus‹, dreien. Also Gebilde, silbenzählende Gebilde, die keine metrischen und eigentlich auch keine rhythmischen, seltsamerweise freirhythmische sind… sein können, ja? Aber sie zählen Silben, was man übrigens nicht zu bemerken braucht. Das sind sozusagen Strukturen oder Formen, denen es lieber ist, nicht bemerkt zu werden. Also der unangenehmste Leser von solchen Haikus oder ›Stutzhaikus‹ ist der, der die Silben nachzählt. Und der hat auch manchmal Erfolg, weils manchmal nicht stimmt, ja? Jetzt kommt noch einmal eben ein Gedicht, das heißt »Rapunzels Haare«, und das sind, wie gesagt, dreimal elf Silben, drei sogenannte ›Stutzhaikus‹. Wenn Ihnen ein besseres Wort einfiele, wäre ich dafür sehr dankbar. Denn es ist ein Sauwort, ›Stutzhaiku‹, das ist unmöglich. (Lachen) Ich dachte schon ›Elfsilber‹ oder irgendsowas, aber es gefällt mir alles nicht. Das zitiert übrigens auch den Text von eben. Aber ich geh den einzelnen Sachen etwas genauer nach, und auch so, daß es den Germanisten entgegenkommt. (Lachen) Und auch Goethe. Und so. Und Goetheforschern und -herausgebern und so weiter. Und dem Herrn Wender zum Beispiel auch. »Demeters Zöpfe / sind dreizeilige Ähren / des Winterweizens. // Hoher Wasserfall, / Rapunzel, Rapunzelchen, / der Strahl ist ein Zopf. // Unbeschreibliches / zieht uns hinan. Weibliches. / Rapunzels Haare.« Was fällt mir eigentlich ein, ja? Zum Beispiel diese Bennsche Geschichte mit dem hohen Wasserfall, ja? Das ist natürlich die unschickliche Variante. Das sagt man eigentlich nicht. Und ich hab auch neulich nochmal erlebt, als ich das mal sagte – übrigens in Gegenwart dieser Freundin meiner Freundin, die mit mir zusammen Rapunzel herausgezogen hat –, die hat sich darüber empört. Die kannte… ich habe dann gesagt, zur Entschuldigung, das ist aber von Benn, ja? (Lachen) Da sagte –
Gerhard Schmidt-Henkel: Du mußt das zitieren, wenn dus im Kopf hast.
A.: Kannst du das?
Gerhard Schmidt-Henkel: Ja, ich überlege gerade. Das steht also… Es beginnt mit dem Begriff ›Beauties‹, also Schönheiten –
A.: Ja. Das sind große Frauen.
Gerhard Schmidt-Henkel: Ja, sind große Frauen, und »langbeinig, hoher Wasserfall, über deren Hingabe man sich gar nicht traut nachzudenken«.
A.: Ja, ja.
Gerhard Schmidt-Henkel: So heißt es –
A.: So wars, ja?
Gerhard Schmidt-Henkel: Ungefähr.
A.: Irgend so ungefähr, ja, ja. [Das Zitat stammt aus »Teils-teils« (Aprèslude, Wiesbaden 1954). Die vierte Strophe des mit »In meinem Elternhaus hingen keine Gainsboroughs…« beginnenden Gedichts lautet: »Aber ein Fluidum! Heiße Nacht / à la Reiseprospekt und / die Ladies treten aus ihren Bildern: / unwahrscheinliche Beauties / langbeinig, hoher Wasserfall / über ihre Hingabe kann man sich gar nicht erlauben / nachzudenken.«] Und die hat dann gesagt: Na und? Ist das vielleicht ein mildernder Umstand, daß es von dem Benn ist? Oder so. (Lachen) Und da ist mir erst aufgefallen, offenbar kannte sie den Ausdruck, aber sie wußte nicht, daß er von Benn ist. Und: er ist nicht von Benn. Es ist… in der Eifel sagt man das. Ja. Das heißt auch, der… – wahrscheinlich auch woanders – der Benn hat natürlich das aufgeschnappt, ja? Aber wir, die wir wenig Kontakt mit dem Volk, ›Volke‹, haben, wir denken dann, das ist Benn. Natürlich wissen wirs von Benn, aber das ist sozusagen Volksgut, ja? Die… das Volk sagt auch manchmal das, was ihm eigentlich einfällt, und was es besser nicht sagen sollte, ja? Ich les das nochmal vor. »Rapunzels Haare // Demeters Zöpfe / sind dreizeilige Ähren / des Winterweizens. // Hoher Wasserfall, / Rapunzel, Rapunzelchen, / der Strahl ist ein Zopf. // Unbeschreibliches / zieht uns hinan. Weibliches. / Rapunzels Haare.« Ja? Ich mein, da freut sich natürlich der kleine Dichter, wenn er diesen schon zum Kalauer gewordenen Ausgang von Faust zwei, »Das Ewig-Weibliche / Zieht uns hinan«, ja?, noch einmal irgendwie weniger störend unterbringen kann. Und auch halb frivol unterbringen kann. Wobei das Halbfrivole in Wirklichkeit ein ganz wichtiges Interessemittel der Literatur ist. Also man kann es nicht so herstellen, daß man sich überlegt, da solltest du noch ein bißchen frivoler sein in dem Text, dann lesens auch die Leute. Aber wenn man nur seine Gedanken zuläßt, falls man welche hat, oder noch welche hat – man hatte immer welche –, dann stellt sich das von alleine ein, nach meiner Erfahrung, und… ja?
Teilnehmer: Herr Astel, ich hätte eine Frage –
A.: Ja.
Teilnehmer: Keine These oder Behauptung. Das zweite, was Sie vorgelesen haben, kam mir so vor, als ob Sie Ihr erstes Gedicht interpretieren würden –
A.: Als ob ich…?
Teilnehmer: Das erste, was Sie vorgelesen haben, interpretieren. Schreiben Sie Interpretationsgedichte zu den eigenen Gedichten? Denn diese ganze Demeter-Sache ist ja in dem ersten Text schon dagewesen.
A.: Ja, aber das Ewigweibliche war noch nicht –
Teilnehmer: Ja doch, ja war ja doch auch… »Das Weibliche zieht uns hinan« war doch im andern schon da –
A.: »zieht uns hinan«, ja, angedeutet. Aber ich will das auch nicht erläutern eigentlich. Es ist nur eine andere Form, ja? Und sie ist meiner Ansicht nach deutlicher, ja? Also strenggenommen, wenn man Skrupel hätte, würde man den ersten Text wegschmeißen. Ich denke aber gar nicht daran. Ja?
Gerhard Schmidt-Henkel: Lieber den zweiten.
A.: Ja, meinst du?
Teilnehmerin: Ich find den ersten auch besser.
A.: Ja? Gut –
Günter Scholdt: Ich finde beide gut –
A.: Danke, danke. (Lachen)
Günter Scholdt: Die passen zusammen. Das stört mich überhaupt nicht, das ist doch so witzig. Warum soll man sich nicht mal selbst interpretieren? Die andern tuns häufig mit so wenig Vermögen, da kann mans doch mal selbst probieren.
A.: Ja, und es ist… fällt einem auch erst allmählich… das, was einem eigentlich einfällt, fällt einem ja auch allmählich ein, ja? Von – wie heißt das in dem Conrad Ferdinand Meyer-Gedicht – von Schale zu Schale und so weiter, ja? Oder »von Klippe / Zu Klippe geworfen«, wer ist das wieder?
Teilnehmer: Hölderlin.
A.: Das ist Hölderlin, ja. Das heißt, auch der Einfall ist ja sozusagen ein Fall, oder ein Wasserfall. Das heißt, es ist nicht gleich da. Es kommt dann dazu, ja? Indem man sich beschäftigt mit der Sache. Da kommt noch Amönau dazu, und all das Liebliche, was man… worüber man nicht reden sollte, und so weiter. Und am Ende sind dann solche Gebilde da. Ist noch lange nicht Schluß, ja? Also ich… An der Stelle möcht ich auch noch etwas sagen – ja, das war genau die Stelle, die ich mir vorgemerkt hatte (Lachen) – zu Gottfried Benn. Gottfried Benn hat ja, irgend so als Atheist, so eine private Metaphysik sich erlaubt, die eigentlich bei seiner weltanschaulichen Grundhaltung nicht erlaubt wäre. Er ist nämlich davon ausgegangen, so ähnlich, wie das manchmal die Bildhauer sagen: im Marmor ist natürlich der ›Kuß‹ von Rodin schon drin, man muß ihn nur rauslassen, ja? oder die ›Umarmungen‹ oder die ›Bürger von Calais‹. Und so hat nun er geglaubt – allerdings ist das ironischer bei den Bildhauern –, aber Benn hat gesagt: eigentlich gibt es die eine vollkommene Fassung. Wir können sie vielleicht erreichen, ja? Aber es ist auch bei ihm der Hintergedanke: eigentlich stehts in den Sternen. Ja? Man muß nur drankommen. Das ist meiner Ansicht nach ein Irrtum. Es gibt sehr viel verschiedene Vollkommenheiten. Ja? Nebeneinander. Und jeden Tag kommt eine andere. Und jeder Tag ist auch anders vollkommen als der vorangegangene, auch jede Stunde. Das heißt, ich glaube auf keinen Fall, daß das irgendwo geschrieben steht, und man muß sich bloß ranrobben, und dann hat mans. Ich denke, wenn man es hatte, kann man es wiederhaben, und völlig anders. Ich erlebe das an mir selber. Vielleicht ist es auch alles Schrott, ja?, aber ich schreib ständig über die gleichen Sachen, ja? Ich könnte fast über jeden Gegenstand ein eigenes Gedichtbuch herausgeben. Weil mich das immer beschäftigt, ja? Es ist für mich nicht abgehakt, ja? Die Sachen bleiben. Die Gegenstände bleiben. Hier die Schale, oder was auch immer, ja? Jetzt hätt ich sie fast zerschlagen. Die ist aber sehr stabil. (Lachen) Die kriegt man nicht so schnell klein. Übrigens –
Teilnehmer: Wo ist denn die Schale tatsächlich her?
Gerhard Schmidt-Henkel: »Swiss made« steht auf dem – (Lachen)
A.: Ja.
Günter Scholdt: Sehr prosaisch.
Teilnehmer: »Cadeaux« –
A.: Cadeaux? Ein Geschenk, aus der Schweiz. Das waren so billige Sachen, die hatten meist noch irgend son billiges Silbermaßwerk. Da konnte man irgenwie Gebäck oder Pralinen reintun und so weiter. Und… ja, das ist das billigste, was es gibt, nicht? Das kriegt man auf jedem Ramsch eigentlich umsonst. Oder für 70 Pfennige oder so. Ja. Aber eigentlich schön.
Teilnehmer: Ich hätte mindestens Delphi erwartet.
A.: Delphi? Nee, nee, nee, nee. Ich mein, das Orakel kann man natürlich auch daraus lesen, ja?
Günter Scholdt: Wenn man genügend trinkt.
A.: Ja, wenn man genügend trinkt und auch… Naja, ich will nicht alles ausplaudern. Ich denke, es ist schwierig für einen Autor, zu beurteilen, was er schreibt. Und ich halte es auch für gefährlich und fast grob fahrlässig, daß man von vornherein sich auferlegt, man schreibt nur Gutes. Also ich lasse einfach das Schlechte weg, und jetzt schreib ich nur Gutes. Warum? Weil mans gar nicht weiß. Ja? Der Einfall ist so beschaffen, daß er irgendwie nicht mit Gütezeichen versehen ist oder Handelsklassen A bis Z oder sonstwas, sondern er hat auch oft die Kategorie ›was fällt dir eigentlich ein?‹, ja? Ziemlich blöd, ja? Ein ziemlich blöder Einfall, Schnapsidee, ja? Aber man kann, wenn man sozusagen so altmodisch ist und auf den… auf die Eingebung oder den Einfall sattelt, ja?, dann kann man nicht von vornherein sozusagen nur die guten zulassen. Weil man es von vornherein nicht weiß. Man weiß auch nicht – es beschäftigt einen ja meist der Gegenstand oder die Sache –, jetzt weiß man gar nicht: gelingt es? Ja? Und sich immer wieder mit den Sachen oder den Gegenständen zu beschäftigen, halt ich schon für – jetzt sag ich ein großes Wort – für glücksbringend. Das ist eigentlich… für mich ist das das Glück, ja? Nicht in erster Linie zu lesen oder zu schreiben, sondern wahrzunehmen, was es gibt. An Handlungen, an Gegenständen. Da sitzt der Martin Bettinger, zum Beispiel. Entschuldige, daß ich dich hier wie in der Schule aufrufe. Du brauchst… ich frag dich auch nichts, ich sage nur etwas. Der war vor kurzer Zeit in Neuseeland. Mit seiner Tochter. Er las, über Internet, die Saarbrücker Zeitung. Was ich übrigens nicht nachempfinden kann. (Lachen) In… auf Neuseeland. Er las dort, daß ich den Kunstpreis des Saarlandes bekommen habe. Daraufhin schrieb er mir mit Luftpost eine Gratulation. In diesem Luftpostbrief waren einige Muscheln, die seine Tochter, die das Glück hatte, mit ihrem Vater in… auf Neuseeland zu weilen, am Strand gefunden hatte. Darunter ein… zum Beispiel das, was man englisch ›abalone‹ nennt, wie heißt das auf deutsch? ›Haliotis‹, das ist aber glaub ich auch Latein, oder so, oder griechisch gar, also irgendwie so ›Seeohr‹ könnte der deutsche Name sein. Und nur eine Scherbe, und die war abgeschliffen im Strand, aber perlmuttrig wie Opal, ja? Und die kam unbeschädigt bei mir an. Von Neuseeland, woher wir auch bekanntlich die Äpfel beziehen, ja?, die schwerer sind, ja? Und das hat mich sehr beschäftigt. Und da muß ich sagen, ich hab auch seine Adresse nicht gewußt, sonst hätt ich mich bedankt. Die war nicht leserlich auf diesem Brief, und ich bitte, das… bitte dich, dies als Dank hinzunehmen. Ich hab das noch. Und so weiter. Und das sind große Sachen, ja? Eine Muschel, sowieso ihre Gestalt, ja? Der Opal, der schillernde Opal. Dieses Seeohr, oder Haliotis, oder Abalone, ja? Viele Leute essen das auch einfach nur. Es kommt aber eigentlich auf die Schale an, das ist das wunderbare, ja? Das andere ist genauso wunderbar, nur können wirs nicht sehen und… Ja. Also diese Gegenstände, die sind für mich sehr wichtig, und ich hoffe eigentlich, nicht nur für mich. Ja. Und jetzt können wir eigentlich zum nächsten Rapunzelgedicht schreiten, falls Sie nicht mich bremsen. Ja, das hab ich hier… Ja, woraus les ich das, hier sehr groß gedruckt? Ein… der Bruder meiner Freundin, Hildegard, der heißt Hans Gerhard, und wie meine Freundin heißt er Steimer mit dem Nachnamen, und der ist der Mitherausgeber, mit Sattler, der Frankfurter Hölderlin-Ausgabe. Und der hat, ohne daß ich ihn darum gebeten habe, angefangen, meine Sachen ins Internet zu ›stellen‹, sagt man, glaub ich. Ja? heißt das so? Ja. Und eigentlich hab ich das nicht verdient, weil ich eigentlich ein absoluter Snob bin und immer über dieses Medium gespottet habe, es übrigens auch nicht bedienen kann. Ich kanns nicht mal selbst mir rausholen, oder runterladen, oder downloaden, oder wie dieses Zeug heißt. Aber ich hab jetzt schon so ein paar Handgriffe gelernt von meiner Freundin, die das kann, und ich bin sehr begeistert. Ja. Ich les jetzt mal ohne weiteres das nächste Gedicht vor, falls Sie nicht Behauptungen aufstellen oder Fragen haben. »Wer flüstert ins Mausohr / Vergißmeinnicht? Wer / läßt sein Haar herunter / aus der Rosette? – / Was springt in die Augen / wie eine Heuschrecke? – / Was ich dir sagen will, / kann ich dir zeigen: / Rapunzel im Wasserglas / läßt ihr Haar herunter.« Dritte Variante, oder vierte schon, so ungefähr. Jetzt müßte man über das Mausohr reden. ›Mausohrsalat‹ wirds ja auch genannt. Ist das geläufig, ja? Ja, ja. ›Mausohr‹ heißt in der lateinischen oder griechischen – es ist wohl griechisch in dem Fall – Nomenklatur ›Myosotis‹; ›myos‹ ist ›der Maus‹, ›otis‹ ›das Ohr‹, also ›myosotis‹. Das deutsche Wort, übersetzt ins Griechische, würde ›myosotis‹ heißen. Das deutsche Wort ›Mausohr‹. So heißt aber Vergißmeinnicht. Das hab ich nicht erfunden. Sondern es ist einfach die botanische Nomenklatur so. Warum? könnte man sich jetzt fragen – übrigens immer interessant, warum? zu fragen und sich zu wundern über so etwas. Das ist das Vergißmeinnicht. Und das hat sehr ähnliche Blätter wie der… wie Rapunzel. Ja? Das heißt, dieser volkstümliche Begriff ›Mausohr‹, den gab es offenbar schon mal früher, und die alten Botaniker haben das Vergißmeinnicht ›Myosotis‹ genannt. Außerdem ist der Mausohrsalat mit dem Baldrian verwandt, so daß er seinerseits ›Valerianella‹ heißt. ›Valeriana‹ ist Baldrian. ›Valerianella‹ ist sozusagen irgendwie son Kusinchen vom Baldrian, ja? Ein anmutiges Kusinchen übrigens, ja? Dieses… und die haben ja… es ist eine… es sind zwei Namen immer, das ist die Binomenklatur der Botaniker. Also ›Valerianella‹ ist die Gattung, und die Art heißt – völlig überraschend – ›locusta‹. Warum, weiß ich bis heute nicht. Aber ich weiß, was ›locusta‹ heißt. ›Locusta‹ heißt die Heuschrecke. Wer das rauskriegt, dem schenk ich ein Buch. Weshalb das so ist, ja? Von den Eine-Mark-Büchern. Das ist übrigens… (Lachen) Aber das ist ein schönes Buch.
Günter Scholdt: Ja, ja. Mehr als ne Mark wert.
A.: Allerdings. Es ist… zwei Mark wert. (Lachen)
Günter Scholdt: Ja, mindestens.
A.: Also jetzt… Auch die botanische Beschäftigung ist natürlich eine Beschäftigung mit Gegenständen, der Natur, ja? Und die Geschichte der Benennungen der Pflanzen, die heute genauso da sind, wenn es Wildpflanzen sind, wie vor Tausenden von Jahren… die haben sich nicht verändert. Die Gärtner strengen sich zwar an, zu züchten und so weiter, und es gibt allerlei Gartenspielarten, aber was so draußen wächst, das Wilde, ist das gleiche. Also sich damit zu beschäftigen, halte ich auch für keinen leeren Wahn. Und das ist jetzt wieder die Stelle in meinem vorbereiteten Vortrag, wo ich erwähnen wollte, daß es eigentlich für eine Universität eine Schande ist, den Botanischen Garten zu schließen. Das wollt ich nur mal kurz hier einflechten.
Günter Scholdt: Der ist doch gerettet?
A.: Der ist nicht gerettet. Der wird schleichend abgeschafft. Die ganzen Rosensträucher sind schon gerodet, es ist eine wichtige, Gattungen und Arten unterscheidende Sache links vom Eingang planiert, da ist inzwischen Kies und zwei Bänke, und die… es ist den Gärtnern überreicht… überantwortet. Und zwar nicht den akademischen Gärtnern, wie Herrn Weicherding, dem Obergärtner Weicherding, den ich sehr verehre, ja? und anderen Leuten. Ein Botanischer Garten, das ist eine wichtige… die Botanik ist eine wichtige Disziplin – wie die Zoologie, ja? – in der Geschichte der Universitäten, ja? Und das abzuschaffen, das sozusagen den Hobby- und städtischen Gärtnern zu überantworten, die dann in Zukunft Spielarten von Tränenden Herzen, ungefähr siebzehn, da anpflanzen werden, ja? das ist… ja, unakademisch.
Zwischenruf: Herzlos!
A.: Wie? Herzlos? Absolut herzlos.
Teilnehmer: Ich habe eine Frage zu diesem italienischen Märchen mit der Petersilie. Gibt es da ein Rapunzelgedicht, das also die Verbindung zu diesem… zu dieser Petersilienvariante herstellt?
A.: Nee. Noch… bisher noch nicht. Da… da arbeite ich noch dran. (Lachen)
Günter Scholdt: Sind auch zu lange Wurzeln.
A.: Das ist alles… wahrscheinlich nicht. Ich kenne übrigens die Wurzeln von Petersilie nicht.
Teilnehmerin: Ich glaube, die… wo ich vorhin dran denken mußte, die wurden von Engelmacherinnen oder zum Einleiten von Fehlgeburten benutzt.
A.: Richtig, richtig.
Teilnehmerin: Und deshalb hab ich vorhin überlegt, warum…
A.: Ja, ja, das ist sehr richtig, was Sie sagen. Ich hab das auch gelesen, und zwar… dieses Rapunzelmärchen, ich weiß nicht, ob Ihnen das gegenwärtig ist. Diese Frau ist ja schwanger, ja?, und hat diese seltsamen Gelüste von schwangeren Frauen. Und die sieht aus ihrem Turmfenster, oder aus ihrem Fenster, in einen fremden Garten, der einer Hexe gehört, ja? Und da sieht sie diesen Feldsalat, ja?, diese Rapunzel. Und sie belästigt ihren Mann, der eigentlich ein anständiger Mann ist und nicht stiehlt. Und der muß jetzt da rüber in Nachbars Garten, was er nicht darf. Und sie quengelt solange, bis er die Rapunzeln da stiehlt, ja? Und dann freut sie sich, und nach einem Mal ist sie auf den Geschmack gekommen, braucht sie immer mehr. Man könnte jetzt natürlich modern und naturwissenschaftlich urteilen, das ist Vitaminmangel. Ja? Die… eine schwangere Frau muß natürlich, speziell im Winter, Vitamine haben. Übrigens – ich bin froh, daß ich wieder von den Gedichten abkomme – die… dieser Feldsalat ist seit der Steinzeit kultiviert. Das haben Funde, Samenfunde, erwiesen. Es gibt… neben dem normalen wilden Feldsalat gibt es einen grüneren, der auch genauso verwildert ist, und den man auch im Freien findet. Der ist nicht mehr gezüchtet jetzt. Und der ist eine Verwilderung einer Jahrtausende lang gezüchteten Art. Und das war natürlich in unseren kalten Regionen der wichtigste Vitamin-C-Träger, ja?, der Feldsalat. Aber jetzt bin ich irgendwie abgekommen. Wo… was war eben? Wo waren wir eben?
Gerhard Schmidt-Henkel: Bei deinem Märchen.
Teilnehmer: Abtreibungsgeschichte…
A.: Ah ja. Ja. Ja, Abtreibung, Petersilie, ja. Da gibts natürlich auch psychoanalytische Deutungen –
Teilnehmerin: … würde man sagen, die Frau will das Kind nicht. Und ich glaube, das Kind gibt sie ja dann auch der Hexe, weil sie ihren Mann retten will, ne? Ich glaub, da könnt man jetzt –
A.: Ja, oder je nachdem. Der Mann verspricht es der Hexe. Muß es der Hexe versprechen, weil er sonst irgendwie in Schwulitäten kommt. Also die Analytiker und die Therapeuten oder, sagen wir mal, auch die Frauenkundigen, ja? – das spielt ja in der Frauenliteratur ne Rolle –, die sprechen davon, das ist, wie man so schön auf Deutsch sagt, ›Doublebind‹. Das heißt, wie das meistens ist, wenn man ein Kind kriegt, man will es, und man will es nicht. Ja? Das ist auch interessant. Das ist auch kulturgeschichtlich natürlich interessant, und bis heute, ja? Das heißt, sie will eigentlich… sie hat dieses Gelüste, sie braucht dies Vitamin – Petersilie ist genauso übrigens ein Vitaminträger wie… wie Feldsalat – sie will es aber auch nicht. Und es galt als ein Abtreibungsmittel. Was natürlich sozusagen der Versuch… der untaugliche Versuch ist. Der übrigens strafbar ist, hab ich mir mal erzählen lassen. Also Abtreibungsversuch mit Himbeersaft ist… wenn man nur den strengen Vorsatz hatte, damit abzutreiben, war das strafbar.
Günter Scholdt: Nein…
A.: Ich hab das als Student mal –
Günter Scholdt: … ist nicht strafbar.
A.: Vielleicht nicht mehr. Aber ich habe das gehört, in einer rechtsphilosophischen Vorlesung, daß der Vorsatz eigentlich einmal reichte für die Strafbarkeit.
Günter Scholdt: Nein, das ist ein untauglicher Versuch, generell.
A.: Ja, aber… Na gut. Also nicht strafbar. Ist ja auch gut…
Günter Scholdt: Nein, weil es sozusagen mit absurden Mitteln gemacht wird. Wenn man zum Beispiel sich selbst beschwört…
A.: Ich glaube, es ist strafbar, wenn ich den Vorsatz habe, Sie zu ermorden, aber…
Günter Scholdt: …das durch Gedichtebeschwörung tue…
A.: …zum Beispiel. (Lachen) Zum Beispiel. Das würde nicht bestraft, nein?
Günter Scholdt: Nein, nein… Das können Sie weiter machen.
A.: Jetzt kann ich nicht mehr weitermachen, weil… ich wollte Sie doch ermorden…
Günter Scholdt: Sie können es straflos weitermachen.
A.: Jetzt fehlt mir ja sozusagen der Glaube an das eigene Werk und die eigene Wirkung. (Lachen) Also ›locusta‹ heißt die Heuschrecke, wie gesagt, und die… der Mausohrsalat heißt botanisch ›Valerianella locusta L.‹, Linné, eine Namensgebung durch Linné. Das ist ne… auch ne Geschichte, womit sich, meiner Ansicht nach, die Leute wenig beschäftigen. Mit der Kulturgeschichte der Pflanzen, die ja eine Sprachgeschichte ist. Im Germanistischen Seminar, in der Seminarbibliothek, ist der vielbändige Marzell. Das ist ein Lexikon der deutschen Pflanzennamen, ja?, das erst in den fünfziger Jahren vollendet wurde, in der DDR übrigens, ich glaube, in der Humboldt-Universität, und dieses Buch, das… Das wird aber jetzt wirklich… geht ein bißchen… schweift ein bißchen aus. Na, also ich will das mal abkürzen und einfach nur die Invektive gegen die Germanisten loswerden. Ich glaub, ich war der einzige, der das benutzt hat. Es ist nämlich im Seminar, in der Seminarbibliothek, nicht aufgefallen, daß der einzige Zugangsband zu diesem Werk fehlt. Das hab ich dann mal jemand gesagt, der da die Bibliothek macht, und er sagte: Das glaub ich nicht. Er hat sich aber dann überzeugt, und dann ist er in die UB gegangen und hat den Band kopiert, und der steht jetzt auch dabei. Was ist das für ein Band? Das Lexikon der deutschen Pflanzennamen ist alphabetisch geordnet nach lateinischen Pflanzennamen. Ja? Man muß also den lateinischen Namen wissen, um den deutschen Namen zu finden. Oder die zahlreichen deutschen Namen, die, unglaublich unübersichtlich und massenhaft, in jeder Gegend andere sind. So daß auch so ne Sache wie ›Mausohr‹ – einmal Vergißmeinnicht, einmal Feldsalat – gang und gäbe ist im Marzell. Der letzte Band, der enthält ein Register, wie man von deutschen Namen zu den lateinischen kommt. Ja? Und ohne den ist es einfach nicht möglich, es sei denn, man ist ein gewaltiger Botaniker. Und das ist, glaub ich, unter Philologen nicht verbreitet. (Lachen) Wenn ich recht sehe. Ich mein, das sind einfach so die Freuden des kleinen Mannes, wenn er dann irgendwas rauskriegt, was da nicht so ist, wie es ist… wie es sein könnte. Und ich habs ja auch verbessert, also –
Teilnehmer: Gibt es denn in der Bibliothek keine Enzyklopädie, in der zu den deutschen Namen die lateinische Bezeichnung steht? Unabhängig vom Marzell?
A.: Ich weiß es nicht, vielleicht im Zedler. Aber der… es ist unmöglich, daß im Zedler alle deutschen Pflanzennamen sind. Es… sie können gar nicht so leicht in ein Lexikon kommen, weil sie in jeder Landschaft anders sind. Also unter Umständen im nächsten Dorf heißt die Pflanze anders. Ja? Und es sind in den einzelnen Artikeln zu einzelnen Pflanzen, die, wie gesagt, nach der lateinischen Nomenklatur geordnet sind, alphabetisch, ja?, aber da muß man erst mal ›Valerianella‹ wissen, um zum Mausohrsalat zu kommen, ja?… (Lachen) Das ist kaum möglich, es geht nicht. Ja. Nicht nur die Philologen sind schlechte Botaniker, auch die Dichter sind schlechte Botaniker, in der Regel, ja? Also… klar. Und ›Maiglöckchen‹ ist doch auch irgend so ein Tarnbegriff für ›Ich verstehe nur ›Rhabarber‹‹. Oder man sagt ›Maiglöckchen‹, wenn man nur auf was anspielen will. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist? Nein? Also meine jetzt schon zum dritten Mal erwähnte Freundin sagt immer ›Maiglöckchen‹. So wie man –
Gerhard Schmidt-Henkel: Zu deinen Gedichten, oder wie? (Lachen)
A.: Nee, wenn irgendwas ist, was man nicht in Gesellschaft sagt, was aber der andere weiß, ja? Das ist so wie ›Teekesselchen‹ oder sowas, ja? Nee? Na, also jedenfalls: um das Gedicht zu verstehen, muß man eigentlich die botanische Nomenklatur verstehen. Genauer gesagt, ich schreibe das Gedicht, um sozusagen diese Nomenklatur plausibel zu machen. So wie sie mir auch erst plausibel wurde. Ich weiß das ja alles selbst nicht. Man sagt dann einem nach: der strunzt mit seiner Bildung, oder: der will uns nur einschüchtern, ja?, weil wir keine Botaniker sind, oder sowas. Nein, das ist es nicht. Ich bin eigentlich selber kein Botaniker, ja? Ich interessier mich nur dafür. Und ich will auch nur festhalten, was mir selbst allmählich klar wurde, ja? Das ist eine ganz spannende Kulturgeschichte, ja? Was ist… zum Beispiel, was hat Plinius eigentlich gemeint, als er eine Pflanze so und so nannte, ja? Was meint Aristoteles eigentlich? Es gibt ja die Benennungen, es gibt griechische Pflanzenbennenungen. Kein Botaniker weiß genau, was gemeint ist, ja? Und dann sind aber immer kulturelle Assoziationen damit verbunden. Zum Teil sind die alten Namen in der Nomenklatur aufgehoben. Man kann nun natürlich jetzt sagen: die Archäologie ist ein leerer Wahn, die Denkmalspflege ist ein leerer Wahn, das geht uns eigentlich nichts an, sondern wir bauen einfach hier so, zwei rechts, zwei links, ja? Das kann man machen. Aber ich bin da schon auf der Seite der Denkmalspfleger. Wie bitte?
Günter Scholdt: Sie wollten mich provozieren.
A.: Überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich bin auf Ihrer Seite. Daß… ich halte es für wichtig, daß diese Dinge Kulturgeschichte sind, ja? Die Wahrnehmungsgeschichte der Natur, die Wahrnehmungsgeschichte der Pflanzen und ihrer Namen, ja? Es handelt sich um Sprache. Das ist Philologie, wenn Sie das wissenschaftlich betreiben. Wie Flurnamen oder sowas, ja? Das ist eine wichtige Kulturgeschichte meiner Ansicht nach. Und ich denke, man braucht sich eigentlich – obwohl ichs dauernd mache – nicht dafür zu rechtfertigen, daß man es tut. Ja? Es ist eigentlich… ich find das… ich find es eigentlich normal. Sagte der Verrückte. (Lachen) Also, noch einmal: die Pflanze heißt ›Valerianella locusta‹, Linné, ›L.‹ abgekürzt, und das Vergißmeinnicht heißt ›Myosotis‹, und das heißt nun wieder ›Mausohr‹. Und deshalb steht über diesem Gedicht, völlig verwirrend – jetzt auch im Internet –, »Valerianella myosotis A. & Valerianella locusta L.« Also das ist Linné, und der andere Botaniker bin ich selber. (Lachen) Aber das ist natürlich nur ein ›Fake‹, ja? Aber jetzt, wo ich so lange darüber geredet habe, wird Ihnen dieses Gedicht wahrscheinlich näher kommen. Und auch die Heuschrecke. »Wer flüstert ins Mausohr / Vergißmeinnicht? Wer / läßt sein Haar herunter / aus der Rosette? – / Was springt in die Augen / wie eine Heuschrecke? – / Was ich dir sagen will, / kann ich dir zeigen: / Rapunzel im Wasserglas / läßt ihr Haar herunter.« Wärs das, oder nicht?
Günter Scholdt: Das weiß ich nicht. Gut –
A.: Ich möcht… ich habe natürlich tausend Gegenstände. Und zehntausend Gedichte. Also –
Teilnehmer: Sie haben doch noch nen zweiten Gegenstand rumgehen lassen, nicht? Milchkannendeckel.
A.: Ja, ja, einen Milchkannendeckel.
Teilnehmer: Und was hat es damit auf sich?
A.: Den hab ich auf –
Teilnehmer: Sie kommen vom Wein dann zur Milch der frommen Denkungsart, oder nicht?
A.: Ja, genau, genau. Sehen Sie, wir sind auf dem Wege –
Teilnehmer: Also an dem Punkt wollt ich mal… das hatten Sie ja so vorgesehen, nicht?
A.: Ja, ja, hatte ich genauso vorgesehen, ich freu mich auch, daß Sie an der richtigen Stelle das Stichwort mir geben. (Lachen) Hier wollte ich sagen, daß ich diesen Deckel einer Schafsmilchkanne auf Sardinien gefunden habe, in der Ruine eines sehr bescheidenen Schäfers. Ein Steinhaus, das schon völlig ruiniert war. Und im Gebüsch war dieser Deckel. Den sah ich da, ja? Ramponiert, so wie er ist, ja? Und auf Sardinien, wo ich mich manchmal aufhalte, da ist berühmt der Schafskäse – wie heißt er eigentlich?
Teilnehmer: Pecorino.
A.: Pecorino, natürlich. Ja. Und da denk ich mir, was die Alten konnten, können wir eigentlich auch. Das heißt, ein Gegenstand… es gibt auch Gegenstände der Erinnerung. Es gibt auch Hinterlassenschaften, die irgendwo rumliegen. Wenn die Leute schon längst irgend etwas anderes machen, längst fernsehen. Aber die sind noch auf… mit ihren Schafen rumgezogen und haben in unheizbaren Häusern, die inzwischen verfallen, die kalte Jahreszeit zugebracht. Der Winter ist auch auf Sardinien relativ kalt, vor allem, wenn man nicht heizen kann. Und mich persönlich rührt das: in einem Land, das für mich Reste von – in Anführungszeichen – Arkadien hat, ja? Nämlich ein Hirtenland. Arkadien war ja bekannlich auch kein liebliches Land, sondern sehr rauh, ja? Da nun Reste dieser Leute, die da gewohnt haben und gelebt haben, und der… den Pecorino gibts heute noch, ja? Also es gibt Genossenschaften, ja? Und bis man so… die Kanne für diesen Deckel, die ist nicht größer als so. Und da muß man die ganze Schafherde melken, um das vollzukriegen, ja? Und ein Schaf zu melken, das ist, glaub ich, auch… das können weder Dichter noch Philologen, glaub ich. (Lachen) Ich kanns auch nicht, Gottseidank. Ja? Die Inschriften auf dem Deckel sind nach… nach Maßgabe alter Epigramme gearbeitet, ja? Ich glaube… ja. So, wie sie in der Griechischen Anthologie stehen. Das ist uns so durch die Übersetzer und durch die Klassiker vertraut geworden. Im Grunde ist das etwas uns ganz Fremdes. Ja? Also die direkte Art, zum Beispiel freirhythmisch zu sprechen oder zu schreiben, ist ja eigentlich die volkstümliche Art. Das heißt, das ist etwas, was in der Sprache ist, bevor sie Literatur wird, ja? Die akzentuierte Rede, die Affektrede. Also ich will festhalten: bei Rapunzel ist die wichtige Sache der Strukturvergleich der Wurzel mit den Haaren. Und der ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Aber Naturdinge, auch die Nomenklatur, auch wenn sich niemand um Botanik kümmert – ist es denn eigentlich eine Bringschuld, die ich habe, wenn ich mich dafür interessiere? Muß ich das eigentlich begründen? Ich würde sagen, eigentlich ist der in der Schuld, der sich darum nicht kümmert, was wächst, ja? Was ist das Mauerblümchen, das er jeden Tag sieht? Aber er sieht jeden Tag den Wetterbericht im Fernsehen, ja? Also eigentlich ist das keine Bringschuld. Ich sag das jetzt – das klingt aggressiv, ich mein das nicht aggressiv. Und es hat ja dann auch noch irgend so einen pädagogischen Touch, ja? Das heißt, ich gebe ja sozusagen mein Wissen weiter, ja? Und das ist mir nicht auf der flachen Hand gewachsen. Das kommt allmählich, wenn… indem ich mich interessiere… also es ist irgendwie, um wieder akademisch zu reden, die Verbindung von Forschung und Lehre. Ist das so richtig? (Lachen)
Gerhard Schmidt-Henkel: Ja, ich seh nie genug, ob du eben sagen könntest, daß Nomenklatura, also eine Anordnung von Namen… Namen sind Mythen oder versteckte Mythen, und die findest du?
A.: Ja, das ist natürlich auch… ich denke natürlich, daß Literatur auch in irgendeiner Weise eine Orakelfunktion hat und mit Geheimnissen zu tun hat, ja? Der Hölderlin, den wir alle schreiben können, und der uns so leicht über die Lippen geht – verstehen tut ihn niemand, ja?
Gerhard Schmidt-Henkel: Goethe sagt: Sag es niemand, nur den Weisen.
A.: Weil die Menge gleich verhöhnet: / Das Lebendige will ich preisen, / Das nach Flammentod sich sehnet. / … / Und so lang du das nicht hast, / Dieses: Stirb und Werde! / Bist du nur ein trüber Gast… ein… ein flüchtiger?
Teilnehmer: Ein trüber –
A.: Dunkler?
Teilnehmer: Trüber Gast / Auf der dunklen Erde.
A.: …trüber Gast / Auf der dunklen Erde. Verstehst du? Das ist im Grunde auch ne Antwort darauf, ja? Es… das betrifft uns… würde uns betreffen, wenn wir uns davon treffen lassen würden. Und da meine ich, es ist nun nicht… nicht rühmlich, sich davon nicht treffen zu lassen. Und auch nicht überflüssig, seine Wunden vorzuzeigen, wenn man davon getroffen wurde.
Günter Scholdt: Ich merke schon die ganz typischen Geräusche, die indizieren, daß die Zeit abgelaufen ist –
A.: Ich glaube auch. Ja, es ist schon… wird gleich sieben, ja.
Günter Scholdt: Wir habens gar nicht gemerkt, was ein Kompliment natürlich ist für die Vorstellung. Meine Damen und Herren, ich glaube, zu Recht haben wir uns bei Arnfrid Astel zu bedanken für den heutigen Abend, den er uns hier gestaltet hat. Wenn ich vielleicht etwas leichtfertig und unberechtigt ein Happening angekündigt habe, so war das vielleicht nicht richtig. Stattdessen haben wir aber zumindest ein Privatissimum in Botanik und klassischer Bildung erhalten, das ganze noch verschränkt durch poetische und poetologische Betrachtungen und das ganze dann auch natürlich noch im idealen klassischen Sinne als Mischung von prodesse et delectare. Was wollen wir mehr, was erwarten wir eigentlich mehr? (Beifall)